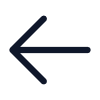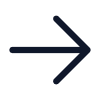DIRK BELL
love
source: initialaccesscouk
Born 1969 Munich.
Lives and works in Berlin
Dirk Bell’s works are mesmerising. romantic, and apparently without irony, his images are soporific and dreamlike, often reminiscent of Wiliam Blake’s interest in Christian theology and Gothic art, suggesting the mystery and trepidation of fairy tales and legends. His photographic works, pinned straight to the wall, explore the differing expressive connotations of black and white, His painting, using a slightly wider palette, employs figurative imagery familiar from classical art and surrealism: the conch shell, vaginal and alluring; a vase of flowers seemingly in-between decay and vitality, all framed by a shape, rendered in glittering powder, implying the womb. Yet his works that are most startling resemble a surrealist take on the Gothic, with effaced figures, nightmarish motifs and strange symbols peppered ominously throughout. They contain echoes of armless statues found in museum collections, the shape of a phoenix or an odd figure on horseback surface from the miasma, a dreamlike state unsettlingly synthesised. Particularly when rendered in black and white, Bell’s work is evocative of the Turin Shroud, (apparently the first example of photographic development attained by soaking a sheet in lemon juice and urine then placed over a subject sitting in the sun). But the work only hints at figurative elements, instead Bell’s images, symbols and words are scattered throughout the work in a manner similar in intent, although radically different in technique, to the free association of subconscious thoughts found in Freud and the Surrealists. In Unholy Truths two doors hang open, on one a faint visage emerges from the gloom accompanied by a warning message not to pass through the door into the oblivion beyond, the other conceals a discoloured, androgynous nude hidden behind the gaze of a feminine countenance. There is an immediacy about the execution of Dirk Bell’s work that accentuates the ephemeral nature of his subject matter as if his images themselves are in danger of disappearing before they can be entirely understood.
.
.
.
.
.
.
.
.
source: guardiancouk
Love and longing aren’t subjects many artists are interested in these days. Sentiment comes cheap in throwaway pop songs and in advertising. Which makes Dirk Bell’s fuzzy-edged quixotic work, tackling the big, tangled, ineffable stuff, a bold anomaly. The German artist stirs up a dust cloud of feelings, dreamy visions and strange esoteric symbols to freshly coat and confuse the 21st-century world.
Bell typically builds associations across radically diverse works. This might include drawings as delicate and intricate as a cobweb, sketched on yesterday’s newspaper, and paintings salvaged from street markets, where Bell’s own ghostly forms embrace those of forgotten artists. Yet this mysterious fare, blending past and present, real and fantastical, is paired with hard-edged creations.
The mood shifts rapidly, from the gentle touch of gauzy drawings to the harsh slap of bright, messy paint. References and symbols might resurface across eccentric assemblages of junk-shop finds, light works and, most recently, industrial-looking metal text sculptures and paintings that fold the letters of the word “love” into a self-enclosed logo like the VW icon.
Bell’s current London show, Soft is Hard (Work), explores the real and the fake – be that an original artwork and a digital reproduction, an event and its memory, or a beloved and our fantasies. Its centrepiece is an idiosyncratic constellation of found detritus and the painstakingly hand-worked. A bald, partially-limbed mannequin reclines on a gutted black leather couch, rescued from the street. Swirling shapes coat its body in a silvery graphite skin, while two red teapots are positioned like planets orbiting the sun of an old lamp. (One of Bell’s references here is Tarkovsky’s 1972 metaphysical sci-fi film Solaris, in which a space traveller meets the double of his dead wife.)
Behind this, a huge drawing hangs, its layered forms coming in and out of focus. Here the chequered pattern of the couch resurfaces, dissolving into Bell’s Love icon as it unfurls across the paper. At the drawing’s centre stands a Blakean figure, beneath occult symbols of an eye and a crescent moon. Images and ideas shimmer and dissolve; everything seems in flux, uncertain, just out of reach.
Why we like him: For Untitled 2012, a reworked reproduction of what was once considered Rembrandt’s greatest achievement, The Man With the Golden Helmet, before it was attributed to one of his students and denigrated as an art historical also-ran. He transforms his fake of a fake into a trippy evocation of introspective reverie, fusing the original dark figure with a spectral waif based on a photo of a Pina Bausch dancer.
Street art: Bell finds many of the old paintings he uses at Mauerpark, the legendary flea market in his native Berlin.
.
.
.
.
.
.
.
.
source: frieze-magazinde
Ist Dirk Bell der Lumpensammler der Kunstgeschichte? Wer einmal um seine raumgreifende Installation Amaia (2007) läuft, könnte das fast denken: Da imitiert eine Schaufensterpuppe, ohne Haar und linke Hand, dafür mit einer Silvesterrakete im Arm, die Pose des auf Inspiration wartenden Malers. Vor ihr steht ein einsamer weißer Teller, in dem die schwarze Farbe bereits eingetrocknet ist, und eine meterhohe Staffelei. Die vermeintliche Leinwand darauf entpuppt sich jedoch als alter rotbrauner Linoleumfußboden, stückweise ausgeschnitten aus Bells Atelier und auf Holzpaletten getackert, die die Staffelei nach links, rechts und oben erweitern. Die Puppe ist dagegen fein überzogen mit einem Gespinst aus Zeichnungen, deren Stil zwischen altmeisterlichen Körperstudien und dem Plattencover einer Heavy Metal-Band schwankt.
Bell hat sich in der Tat in den vergangenen zwei Jahrzehnten, die seine erste umfassende Museumsausstellung in der Pinakothek der Moderne in München mit dem Titel Retour zeigte, stilistisch durch so gut wie jede Kunstepoche seit der Renaissance gearbeitet von der jugendstilartigen weiblichen Aktzeichnung über die von Surrealisten so geliebte Installation mit verstümmelter Schaufensterpuppe bis hin zur minimalistischen Leuchtröhrenskulptur und wieder zurück zur romantischen Abendstimmung auf Leinwand. Doch genau in dem Moment, in dem das Kennerauge die entsprechende kunsthistorische Schublade öffnen will, um die jeweilige Arbeit einzusortieren, bricht Bell diesen Wiedererkennungswert. Dann wird übermalt, mutwillig zerstört oder pathosschwer gerahmt und der Versuch, diese Werke zu fassen, kann von Neuem beginnen.
Auch die monumentale Skulptur FREE LOVE (Freie Liebe, 2011) spielt mit falschen Erwartungen, die in diesem Fall der Titel weckt: Denn die mächtigen Stahlstreben, aus denen die Buchstaben von Free und Love gebildet sind, schieben sich hier fast martialisch ineinander; von den beiden Worten bleibt im ineinander verkeilten Quadrat und Kreis nicht viel übrig, wie Pockennarben sind ihre Stäbe noch dazu von unzähligen Schweißnähten überzogen. Nach großer Freiheit sieht FREE LOVE dadurch nicht aus, auch nicht nach der Leichtigkeit des im Titel beschworenen Gefühls; freie Liebe erscheint hier in ihrem Anspruch vielmehr als einschüchternder Käfig. Einem tonnenschweren Raumtrenner ähnlich teilte diese Skulptur, die im Zentrum der gesamten Schau stand, die Ausstellungsfläche in vier Bereiche. Ihre Achsen setzten sich in vier Trennwänden fort, die jedoch für keine chronologische oder thematische Ordnung der darauf ausgestellten Arbeiten sorgten.
FREE LOVE ist speziell für die Ausstellung in München entstanden und wirkt dabei wie das Extrakt der so unterschiedlichen Arbeiten von Bell: Denn ohne Scheu hat sich hier jemand von Neuem an eines der ganz großen Themen der Kunst gewagt die Liebe. Da wird der Frauenkörper hingebungsvoll aufs Zeitungspapier aquarelliert, die Brust mit Kreide aufs Papier gehaucht oder virtuos auf Transparentpapier gezeichnet; da werden auch schon mal die weiblichen Umrisse in eine schwarze alte Holztür eingeritzt. Vor allzu viel Gefühl schützt Bell dabei sein Interesse für gesprächiges Material. An den angestoßenen, verkratzten und von der Zeit so sorglos behandelten Oberflächen perlt der zweifellos vorhandene romantische Jungs-Kitsch der Motive einfach ab. Die Fundstücke erzählen ihre eigene Geschichte. Gut, dass Bell so gerne sammelt.
.
.
.
.
.
.
.
.
source: diamondpaperde
Dirk Bells Kunst nähert man sich am besten auf verschlungenen, um nicht zu sagen verwunschenen Pfaden. Sie führen mich zu seinem Atelier in das seltsame Niemandsland zwischen Berlin-Mitte und Wedding, in eine kleine Seitenstraße, die zu einer Baugrube weist und in der sich eine Endhaltestelle der für Ostberlin charakteristischen Trambahn befindet. Diese Straße ist eine Art Zwischenraum, einer jener Orte, nach denen man Heimweh hat, während man doch zu Hause ist, und in die man, wenn man noch vor einigen Jahren durch Berlin spazierte, alle Nase lang geriet.
Vielleicht sind es solche Orte, Straßen wie diese, an denen alles unbestimmt ist und nichts festgelegt erscheint, die leer stehenden Geschäfte und das aufgerissene Kopfsteinpflaster und ähnliche romantische Zuschreibungen, die Berlin für Künstler wie Dirk Bell heute immer noch zu einem Versprechen machen — von dem ich glaube, dass er hartnäckig daran arbeitet (oder eben auch nicht), bestimmte Klippen zu umschiffen, der sich beständig neue Fallen stellt und wieder anderen ausweicht.
Entgegen allen Erwartungen meinerseits stellt sich Dirk Bells Atelier nicht als Wunderkammer dar. Vielmehr ist es eine etwas verrumpelte Wohnung im zweiten Stock eines gerade frisch renovierten Wohnhauses. Der hier herumgeistert, reicht seinen Besuchern Tee.
Dirk Bell führt mich in seine „Bibliothek“, ein Zimmer, in dem er neben einer Ansammlung von Büchern, Katalogen und Zeichnungen große Mengen von „Perry Rhodan“, „Atlan“ (Sohn von Atlantis)und „John Sinclair“-(Dämonenpeitsche)
-Heftromanen hortet. Er erzählt, wie sehr ihn der Stil der Titelillustrationen in seiner Jugend und Hochschulzeit geprägt hat und immer noch zu begeistern vermag. Einige der Cover faszinierten ihn besonders, da sie neben ihrer offensichtlich „fließbandartigen“ Entstehung auch genuin „künstlerische“ Merkmale aufweisen. So erinnern die Strukturen außerweltlicher Felsformationen nicht selten an Dekalkomanien von Max Ernst.
Ein weiterer Haupteinfluss, der noch in den Arbeiten der frühen Ausstellungen in seiner Stammgalerie BQ in Köln („Why are my friends such finks“, 1998, zusammen mit F. Kunath) anklingt, breitet sich in Form auf losen Blättern scheinbar unzusammenhängend verteilter, skizzenhaft wirkender Zeichnungen vor mir aus: Pferde und Barbaren mit exzentrisch gekrümmten Hörnern, Frauengestalten und bizarre Landschaften, stark schraffiert aufs Papier getuscht, verweisen auf die archaisch-kitschige Bilderwelt des amerikanischen Comiczeichners Frank Frazetta. Dessen „Hauptwerk“, der zusammen mit Ralph Bakshi (bekannt durch die Adaptionen von „Fritz the Cat“ nach Robert Crumb und „Der Herr der Ringe“ fast fünfundzwanzig Jahre vor Peter Jackson) gestaltete Zeichentrickfilm „Feuer und Eis“ ist auch ein erklärter Lieblingsfilm Dirk Bells. Langsam beginne ich zu glauben, dass der gerne als Höhepunkt des Eskapismus geschmähte Fantasyboom der frühen achtziger Jahre einen nahezu unauslöschbaren Eindruck bei Menschen in Dirk Bells (und meinem) Alter hinterlassen haben muss.
Für Dirk Bell als Zeichner sind Künstler wie Frazetta, H. R. Giger, Leonor Fini oder selbst der notorische Bruno Bruni so interessant und bilden wichtige Bezugspunkte, weil sie sich, nach künstlerischen Kriterien beurteilt, auf ausgesprochen unsicherem Terrain bewegen. So wie Dirk Bells Atelier im „Niemandsland“ zwischen dem hippen Mitte und dem proletarischen Wedding liegt, finden die oben Genannten in einer Art Zwischenwelt zwischen Postergalerie und Kunstbetrieb statt. Die Beschäftigung mit Figuren, die sich in einer Art „Zone“ aufhalten und an die man sich nur im Zickzackgang annähern kann (um Tarkowskis „Stalker“ zu zitieren, einen weiteren seiner Lieblingsfilme), verhindert laut Dirk Bell eine zu frühe Versteifung auf den Kunstbetrieb und erscheint ihm immer reizvoller als „schon in der Akademie ständig mit einer Flash Art-Nummer unter dem Arm herumzulaufen“.
So scheint mir seine Verbundenheit mit Fantasy-Illustratoren, Gebrauchssurrealisten und Airbrush-Artisten weniger ein koketter Flirt mit der „low art“ zu sein, kein Versuch, einen Distinktionsgewinn aus dem Verweis auf vermeintlich „verpönte“ Kunstgattungen zu ziehen, als vielmehr ein notwendiges Verfahren, um allzu früher Konsolidierung im Kunstbetrieb vorzubeugen. Auch und vor allem deshalb stellte und stellt Berlin ein Versprechen für Künstler wie Dirk Bell dar, weil sich hier aufgrund der viel beschworenen „billigen Mieten“ und leer stehender Räume einigermaßen einfach Nischen finden lassen, in denen man sich abseits vom Galeriebetrieb aufhalten kann. So betätigte sich Dirk Bell bereits des öfteren als Bar-(Mit)betreiber, zuletzt in der immer etwas grottenartig wirkenden „Apotheke“ in der Schönhauser Allee, arbeitete an einer Nummer des vom Arbeitskreis „Neue Dokumente“ erstellten Freier — Magazin für Befindlichkeit mit und befasst sich überdies mit der Herstellung von Schmuck.
Dabei ist Dirk Bells Vorgehensweise niemals zielgerichtet und lässt nichts von der bemühten „Macher“-Mentalität spüren, mit der man bei ähnlichen Positionierungen oft konfrontiert ist.
So delikat und tatsächlich „meisterhaft“ viele der großformatigen Zeichnungen auch sein mögen, die er in jüngster Zeit anfertigt, so wenig „verfrickelt“ erscheint mir sein Ansatz. Vielmehr kommen mir diese Zeichnungen wie das Ergebnis einer mit langem Atem betriebenen performativen Geste vor, während derer kein Weg vorgezeichnet ist. Wie der von ihm bewunderte William Blake arbeitet Bell „only when to do so, commanded by angels“. Die Annährung an das zu zeichnende Sujet geschieht dabei nicht in der Suche nach dem Äußeren des Objekts des Verlangens, vielmehr entspricht das Objekt der Innerlichkeit des Verlangens. Dieser im Batailleschen Sinne erotische Vorgang (und ich glaube Dirk Bell ist ein „großer Erotiker“) ist in jeder Station der Arbeit an einer Zeichnung deutlich. Ein Bild kann so als ein Kopfporträt einer Freundin Bells begonnen werden und sich im Laufe seiner traumwandlerischen Arbeit in eine Wiederkehr von Pontormos „Leda“ verwandeln, deren Körper sich in den eines Knaben mit aufgerichtetem Geschlecht verwandelt. Dieses hermaphroditische Geschöpf verbindet sich wie in Tschaikowskys Ballett „Schwanensee“ küssend mit einem Schwan, der wiederum aus einem ephemeren Liniengeflecht erwächst, und wird so vom Tod ins Leben zurückgeholt. („Ohne Titel“, 2003). Ein ähnliches Motiv kann, als Detailansicht, geisterhaft aus einem Offsetdruck mit Bruno-Bruni-Lilien entwachsen, so wie sich hinzugefügte weiße Kreide auf einem verblichenen Flohmarktbild einer Gitarre spielenden Frau wie Ektoplasma ausbreiten kann. Es sind dies Transformationen, die aus Annährungen entstehen, denn Dirk Bells Welt ist die Welt der Ähnlichkeiten und Analogien, der Verschmelzung von scheinbar gegensätzlichen Prinzipien, der Blake$$$schen „marriage between heaven and hell“. Wie die zweideutigen Gestalten in Gustave Moreaus Bildern oder die Protagonisten in „Lesbia Brandon“ des obersten aller englischen decadents, Algernon Swinburne, sind alle Personen in Dirk Bells Bildern durch zarte verwandtschaftliche Bande miteinander verknüpft. Die Liebenden sehen aus wie Geschwister, die Symbole von Gut und Böse verschmelzen und verflechten sich in doppelter und dreifacher Weise. Es gibt keine Gegensätze zwischen Alter, Geschlecht und Typ: Der geheime, gemeinsame und befreiende Sinn aller Darstellungen scheint die Idee des Inzests zu sein.
Die Dualität zwischen Licht und Schatten, Nacht und Tag, Feuer und Eis, diese symbolhafte Ambivalenz bildet auch das Grundprinzip in Dirk Bells jüngsten Arbeiten, die aufgrund ihrer extremen Hochformatigkeit nicht selten an Darstellungen von Tarotkarten erinnern, beispielsweise an das 1944 von der englischen Künstlerin Frieda Harris gestaltete, berühmte „Aleister-Crowley-Tarot“. Überhaupt spuken die mehr oder weniger geheimen Lehren dieses englischen Exzentrikers und glühenden Nietzsche-Verehrers, Yogameisters und Tantrikers mit schöner Regelmäßigkeit in Dirk Bells Werk herum, und sei es nur indirekt über den massiven Einfluss Kenneth Angers, der in diversen Zeitschriftenbeiträgen, Monografien und Ausstellungen (zuletzt sehr schön bei Modern Art in London) sowieso zurzeit eine Auferstehung zu feiern scheint. An dergleichen esoterische Traditionen erinnerte auch das Deckenfresko, mit dem Bell die BQ-Koje bei der letztjährigen Art Basel versah, das, ganz aus Kreisstrukturen komponiert, auf den so genannten „Baum des Lebens“ der jüdischen Kabbala zu verweisen schien. Spätestens hier kann dem/der Betrachter/in schon mal etwas schwindelig werden.
Jedoch, wie eingangs erwähnt, ist Dirk Bells Kunst nie einseitig rubrizierbar und erschöpft sich nicht in der Erfüllung gängiger Klischees. So gegenwärtig Spätrenaissance, Symbolismus, Romantik und Esoterik in seinem fast klandestin anmutenden Werk auch sind, so unpassend scheint ein ohnehin fragwürdiges Label wie „neue romantische Malerei“ für ihn zu sein. Vieles an seiner Haltung gegenüber der gängigen Ausstellungspraxis erinnert vielmehr an die institutionskritische Kunst der neunziger Jahre, und zuletzt wusste er mit Anklängen an die klassische Avantgarde zu überraschen: Bei der Gruppenausstellung „Jetzt und zehn Jahre davor“ Ende letzten Jahres in den Berliner Kunst-Werken zeigte er zwei Objekte, die (eines davon in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Juliane Solmsdorf) an Man Ray oder eine abgeschrabbelte Version von Marcel Broodthaers gemahnten. Zu durchdrungen von der Moderne und zu wenig trivial sind seine Arbeiten, zu skeptisch ist Dirk Bell gegenüber sich selbst der „Intention“, zu dialektisch ist sein Verfahren, zu überraschend und unzynisch sind seine Ergebnisse, als dass man seine Kunst als sentimental und einem neuen Sensualismus zugehörig klassifizieren könnte. Dirk Bell vermag seine Umgebung genau zu analysieren, zu fragmentieren und kaleidoskopartig neu zusammenzusetzen. Der Blick aus seinem Fenster auf die nahe gelegene Charité lässt diese aus dem Nebel aufsteigen wie eine moderne Variante von Böcklins „Toteninsel“. Seine Arbeiten, so scheint es mir, changieren beständig zwischen Pose und Authentizität: Dinge können sich verändern, wenn man sie gegen das Licht hält, eine Atelierwohnung kann sich in eine Camera obscura verwandeln: Dirk Bell lässt sich im Dunkeln die Bewegungen vorschreiben. Frei nach einem Diktum Gustave Moreaus: „Ein gutes Bild, welches der hervorbringenden Phantasie genau entsprechen soll, muss geschaffen werden wie eine ganze Welt“(1), begnügt sich Dirk Bell nicht mit der Befriedigung von Bedürfnissen, sondern schafft Voraussetzungen, das ebendiese überhaupt entstehen können.
Anmerkung
(1) Zit. n. Mario Praz, „Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik“, München 1994, S. 252.